Sprachliches Relativitätsprinzip ist ein
von dem amerikanischen Ingenieur und Sprachforscher Benjamin Lee
Whorf geprägter Ausdruck, der die alte sprachtheoretische Auffassung
beschreibt, dass mit dem Gebrauch einer Einzelsprache sich eine spezifische
Sicht auf die Welt, die Realität verbinde. Verkürzt wird oft
gesagt: Die Sprache bestimmt das Denken. Aber ein Determinist war Whorf
nicht. Für Whorf ist "die Tatsache, daß Sprachen die
Natur in vielen verschiedenen Weisen aufgliedern, unabweisbar. Die Relativität
aller begrifflichen Systeme, das unsere eingeschlossen, und ihre Abhängigkeit
von der Sprache werden offenbar." (Whorf 1963: 13)
Differenzierter argumentiert der Linguist und Anthropologe Edward Sapir
in seinem 1933 erschienenen Klassiker "Language" / "Die
Sprache":
"Von der
Warte der Sprache aus gesehen, könnte man das Denken als das stärkste
Konzentrat betrachten, das die Sprache hergibt, wenn man jedes der Elemente
eines normalen Sprechakts auf seinen vollen Begriffsinhalt hin ausschöpft.
Daraus ergibt sich ohne weiteres, daß Denken und Sprechen nicht identisch
sein können. Äußerstenfalls kann die Sprache als die nach außen gekehrte
Seite des Denkens verstanden werden und zwar auf dem höchsten abstrakten
Niveau, wo die symbolischen Ausdrucksformen zu Hause sind. Meiner Überzeugung
nach ist die Sprache im wesentlichen eine prärationelle Funktion. Sie
arbeitet sich sozusagen ganz bescheiden in die Höhe bis zu dem Punkt,
wo das Denken, das als latente Möglichkeit in den Kategorien und Formen
der Sprache vorhanden ist, schließlich aus diesen Kategorien und Formen
herausgelesen werden kann. Auf keinen Fall besteht, wie naiverweise oft
angenommen wird, die Funktion der Sprache darin, bereits fertige Gedanken
mit einem Namensschild zu versehen." (Sapir 1961: 22f.)
Weniger strittig ist, dass Sprache in Kultur, in Praxis
eingebettet ist und diese spiegelt. Sprachen markieren, was in unserer
Handlungspraxis wichtig ist, immer wieder vorkommt, und das mag in einer
anderen Lebensform etwas Anderes sein. Das geschieht im Verarbeitungsprozess
des Wissens, wie sich schon bei Sapir andeutet. Im Sprechen fassen wir,
was wir brauchen, für die Kategorisierung zu bestimmten Zwecken,
die Kategorien sind darauf angelegt, dass die Zwecke realisiert werden
können.
Das deutsche System der Verwandtschaftsbezeichnungen reicht uns völlig
aus, für andere Kulturen mag es zu differenziert oder viel zu
einfach sein: Schauen Sie mal auf das Japanische.
Geht es nicht vor allem darum, wie die Kategorien des Wissens sprachlich
für und durch eine soziale Praxis geprägt sind?
Unstrittig ist
auch, dass spezifische Leistungen der Wissensverarbeitung sprachunabhängig
erbracht werden können, etwa das Wiedererkennen von Orten, an denen wir schon
einmal waren, von Menschen, denen wir früher begegnet sind, der Zugang zu Farbnuancen
und Gestalten. Dabei können wir dann aber auch wieder die Sprache und ihre
Kategorien nutzen, wir müssen es, wenn wir das Erkannte weitergeben wollen.
(> Kultur). Kommunikative Teilhabe ist mittels
Sprache auch etwa Blinden möglich: Forschner (2006)
hat gezeigt, wie Geburtsblinde durch ihre Interaktion mit Sehenden auch genuin
visuell bestimmte Konzepte wie Farben begrifflich entwickeln und kommunikativ
sinnvoll einsetzen können; dabei spielt die feldhafte Einbettung im Symbolfeld
(syntagmatisch und paradigmatisch) eine unterstützende Rolle, die im Gebrauch
der Formen aktualisiert wird, visuelles Wissen wird also als sprachliches Wissen
erworben.
Die Grundfrage ist im Blick auf das Verhältnis zwischen der (statisch
gefassten) Sprache und dem (statisch
gefassten) Denken schwer zu bearbeiten. Wir können uns den
modernen Menschen ohne Sprache nicht vorstellen.
Humboldt hat die Sprache als gemeinsames Sprechen-Denken konzipiert,
in und mit der Sprache arbeitet der Geist im Dialog. Die Sprache
existiert nicht als solche, sondern nur als Einzelsprache, so formuliert
er:
"Das Denken ist aber nicht bloß abhängig von der Sprache überhaupt,
sondern, bis auf einen gewissen Grad, auch von jeder einzelnen bestimmten." (...)
Indem nun die Nationen sich dieser schon vor ihnen vorhandenen Sprachelemente
bedienen, indem diese ihre Natur der Darstellung der Objekte beimischen,
ist der Ausdruck nicht gleichgültig, und der Begriff nicht von der
Sprache unabhängig. Der durch die Sprache bedingte Mensch wirkt aber
wieder auf sie zurück, und jede besondre ist daher das Resultat dreier
verschiedner, zusammentreffender Wirkungen, der realen Natur, der Objecte,
insofern sie den Eindruck auf das Gemüth hervorbrint, der subjectiven
der Nation, und der eigenthümlichen der Sprache durch den fremden ihr
beigemischten Grundstoff, und durch die Kraft, mit der alles einmal
in sie Uebergegangene, wenn auch ursprünglich ganz freigeschaffen,
nur in gewissen Gränzen der Analogie Fortbildung erlaubt." (Humboldt
1963: 16, 19)
Es ist sehr schwierig, Sprache und Denken begrifflich so
zu trennen, dass Zusammenhänge, Abhängigkeiten etc. aufzuweisen
sind, zumal wenn sie empirischer Forschung zugänglich sein sollen.
Anhaltspunkte für ein angeborenes bereichsspezifisches begriffliches
Wissen oder ein Sprachmodul gibt es bislang nicht. Es scheint so zu sein,
dass sich im Erwerb sprachliche und mentale Entwicklung wechselseitig
vorantreiben (Sprache mit ihrem Symbolfeld als zentrales Denkmittel,
konzeptuelle Entwicklung als Bedingung und Folge des Wortschatzausbaus),
während
Thesen wie 'erst die Kognition, dann die Sprache' (Piaget) oder 'erst
die Sprache, dann die Kognition' (strikter Relativismus) wohl zu radikal
sind. Ohne die Möglichkeiten impliziten und abstrahierenden Lernens
und ein entsprechendes Gedächtnis, ohne spezifische Wahrnehmungsfähigkeiten
und Zugänge zu Rhythmus und Prosodie, kämen
Kinder nicht zur Sprache und damit nicht zum kulturellen Wissensschatz
und zu entwickelten Denkprozessen. Die Möglichkeit eines Denkens,
einer Wissensverarbeitung auch jenseits der Sprache soll nicht bestritten
werden.
Eine Darstellung verschiedener Positionen gibt Werlen,
Trabant zeichnet das Europäische Sprachdenken nach. Seebaß hat
gezeigt, welche Schwierigkeiten und Untiefen anzutreffen sind, will man
nur das Problem klar und entscheidbar formulieren.
Literaturhinweise:
G. Deutscher (2010) Im Spiegel der Sprache: Warum die Welt in anderen
Sprachen anders aussieht. München: Beck
N. Evans (2014) Wenn Sprachen sterben. Und was
wir mit ihnen verlieren München: C.H. Beck
D.L. Everett (2005) Cultural
Constraints on Grammar and Cognition in Piraha.
In: Current Anthropology Volume 46, Number 4, August–October
2005
D.L. Everett (2010) Das glücklichste Volk. München: DVA
D.L. Everett (2013) Die größte Erfindung der Menschheit.
Was mich meine Jahre am Amazonas über das Wesen der Sprache gelehrt
haben. München: DVA
S. Forschner (2006) Visuelles im sprachlichen Ausdruck. München: Iudicium
W.
v. Humboldt (1963) Schriften zur Sprachphilosophie. Darmstadt: WBG
J.
Lucy (1992) Language diversity and thought: a reformulation
of the relativity hypothesis. Cambridge: University Press
E. Sapir (1961) Die Sprache. München: Hueber
G. Seebaß (1981)
Das Problem von Sprache und Denken. Frankfurt: Suhrkamp
J. Trabant (2006)
Europäisches Sprachdenken. München: Beck
I. Werlen (2002)
Sprachliche Relativität. Tübingen: Francke (UTB)
B.L. Whorf (1963) Sprache
denken Wirklichkeit. Reinbek: Rowohlt

|
 
Genusklassen des Nomens im Teop* (Papua-Neuguinea)
adaptiert aus: The Teop sketch grammar
Ulrike
Mosel with Yvonne Thiesen, University of Kiel (4.3.2008)
*Das Teop hat ca. 6000 Sprecher, die am Meer leben,
vom Fischen und von den Früchten der Palmen leben. Sie bauen
ihre Häuser aus Palmen und arbeiten auch auf Feldern.
|
e-Klasse
(Singular-Artikel ist e) |
a-Klasse
(Singular-Artikel ist a) |
o-Klasse
(Singular-Artikel ist o) |
e Kakato 'männlicher Name'
e Sovavi 'weiblicher Name'
e teetee 'Vater des Sprechers'
e sina-naa 'Mutter des Sprechers'
e beera 'der Häuptling, Anführer'
e guu 'Schwein'
e ta 'das Stück/Teil von' |
a otei 'der Mann'
a moon 'die Frau'
a beikoo 'das Kind'
a iana 'der Fisch'
a overe 'die Kokosnuss'
a kepaa 'das Tongefäß'
a kasuana 'der Strand' |
o demden 'die Schnecke'
o kurita 'der Krake'
o overe 'der Kokosnussbaum'
o paka 'das Blatt'
o hoi ' der Korb'
o kasuana 'der Sand'
o suraa 'das Feuer' |
Aufgabe: Wie unterscheiden sich die Klassen
semantisch?
Lösung |
Wie der Wortschatz die Lebensweise
spiegelt, zeigen die Verben des Tragens :
pate 'mit ausgestreckten
Unterarmen vor sich hertragen
vateen 'in einem Rucksack tragen'
kapee '(ein Kind) auf dem Rücken tragen'
kae 'an einem Henkel tragen'
vadee 'eine schwere Last zwischen zwei
Leuten an einem Stock tragen'
|
Eine aktuelle Diskussion gibt
es über
die Sprache der Pirahã am Amazonas,
erforscht insbesondere von Daniel
Everett. In dem Aufsatz "Cultural
Constraints on Grammar and Cognition in Pirahã",
in Current Anthropology Volume 46, Number 4, schreibt er:
"Pirahã is
the only language known without number, numerals,or a concept of
counting. It also lacks terms for quantification such as “all,” “each,” “every,” “most,” and“some.” It
is the only language known without colorterms. It is the only language
known without embedding (putting one phrase inside another of the
same type orlower level, e.g., noun phrases in noun phrases, sentencesin
sentences, etc.)." (Everett 2005:622)
Everetts These ist, dass die Pirahã-Kultur über
nichts spricht, was nicht unmittelbarer Erfahrung entspricht oder als
Resultat solcher Erfahrung (von Generationen) übertragen wird
(623). Bestimmt also die Kultur die Sprache? Oder bildet sie einen Rahmen, in dem sich eine Sprache als Werkzeug entfaltet, der aber nicht überschritten wird? So sieht Everett es.
Sprache und Kultur sind eng verwoben, Sprache manifestiert, übermittelt,
tradiert Kultur. Everett schreibt, dass Pirahã-Angehörige
andere Sprachen wie Portugiesisch - trotz Kontakt - nicht richtig lernen,
weil die kulturelle Beschränkung
sie daran hindere.
Auch die Verwandtschaftsbezeichnungen lassen kulturelle Rückschlüsse zu. Welche?
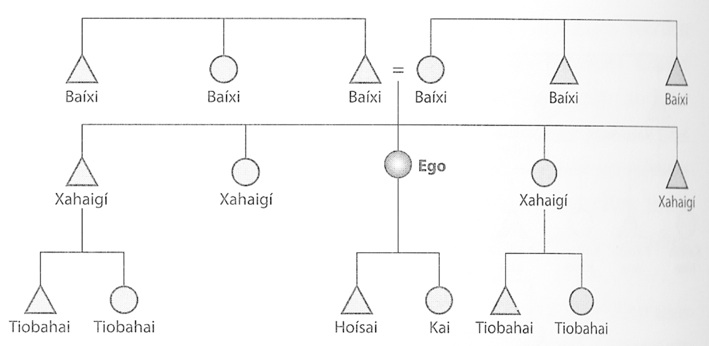
Verwandtschaftsbezeichnungen der Pirahâ: O weiblich Δ männlich aus:
Dan Everett (2013) Die größte Erfindung der Menschheit. München: DVA, 334
Wenn das alles korrekt ist, wäre zugleich die
Chomsky-Position - Sprache wird kulturunabhängig als grammatisches
System, genetisch angelegt, erworben - nicht haltbar. Fraglich ist
nach Everett auch von Chomsky vertretene These, dass Rekursion, Einbettung
ein zentrales Merkmal menschlicher Sprachfähigkeit
sei (auch von Dixon dargestellte australischen Sprachen scheinen
Gegenbeispiele zu liefern). Nebensätze, attributive Nominalgruppe,
Koordination etc. seien im Pirahã nicht
vorhanden. Auf den Text folgen interessante Diskussionsbeiträge,
im Netz findet sich Weiteres, etwa ein Log von G.
Pullum, ein Bild,
der Kommentar
von Gordon in Science.
Doch wie ist das: Zählt man nicht,
wenn man keine Zahlwörter hat?
Die Fragen bleiben spannend: Geht es um Zusammenhänge von
Sprache und Denken, geht es um das kulturelle Fundament der Sprachen,
braucht man eine bestimmte Kultur, bestimmte kognitive Fähigkeiten,
um eine Sprache lernen zu können?
Vg. die Everett-These und
Diskussionsbeiträge (van Valin
u.a.) in EDGE.
Eine ethnographische und linguistische Darstellung von Erfahrungen
mit der Kultur der Pirahǎ ist:
Daniel Everett (2010) Das glücklichste Volk. Sieben Jahre bei den Pirahǎ-Indianern
am Amazonas. München: DVA
Das Buch bringt zugleich die Lebensgeschichte von jemandem,
der als Missionar des evangelikalen "Summer Instituts of Linguistics"ausgezogen
war, den Pirahǎ den christlichen Glauben zu bringen .... und was daraus
geworden ist. Zur These von Sprache als kulturellem Werkzeug:
Dan Everett (2013) Die größte Erfindung der Menschheit. Was mich meine Jahre am Amazonas über das Wesen der Sprach gelehrt haben. München: DVA
Homepage von Dan
Everett.
Zum Pirahǎ auch dieser
Aufsatz von Everett.
Dazu
auch Grund
4; zu den Sprachen: The
World Atlas of Language Structure
|
|